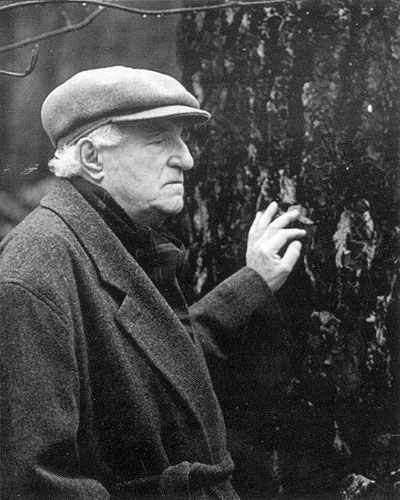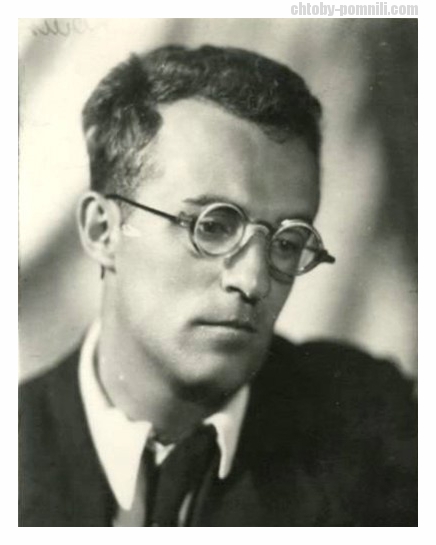Ein Zeitzeugengespräch mit dem Komponisten Vladimir Genin, geführt und niedergeschrieben sowie durch Hörbeispiele ergänzt von Jon Michael Winkler, Musiker und Komponist
Redaktion und Text-Gestaltung: Gaby dos Santos
„Georgi Swiridow? Nie gehört ..!“ – Mit dieser Wissenslücke steht man hier in Deutschland alles andere als alleine da. Auch mir ging es kürzlich so! Auf Einladung von Tatjana Lukina, Gründerin und Präsidentin des russischen Kulturzentrums in München MIR, saß ich mit meiner Kollegin und Freundin Gaby dos Santos im Carl-Orff-Saal des Münchner Gasteigs. Gebannt lauschten wir den Werken, die auf der Gala zu Ehren des 100. Geburtstags von Swiridow geboten wurden, ein Künstler, der mir bis dato vollkommen unbekannt gewesen war. Die Ränge und Reihen waren entsprechend zum großen Teil von Russisch sprechenden ZuhörerInnen besetzt, was die außerordentliche Popularität des Komponisten in seiner Heimat unterstrich.
Dort gilt er als ein ganz Großer; anlässlich seines Todes bezeichnete Russlands damaliger Ministerpräsident Viktor Tschernomyrdin ihn als „wahren russischen Musiker“ … Und die zu Gehör gebrachten Werke schlossen in der Tat bei mir eine Bildungslücke: Ich erlebte Swiridow als einen großartigen Komponisten, der auch hierzulande einen größeren Bekanntheitsgrad verdient hätte! Auffällig war dabei seine stilistische Bandbreite:
Der Einfluss seines wenige Jahre älteren Lehrers Dimitri Schostakowitsch (z.B. 1940 in seiner Kammersymphonie ), von dem sich Swiridow aber bald löste, um sich der Quelle der russischen Musik zuzuwenden, dem Volkslied sowie – in seiner letzten Schaffensperiode – der geistlichen Chormusik der russisch-orthodoxen Tradition. Dieser Zuwendung verdankt seine Musik die eingängige Melodik, die ihm von der „modernistischen“ Seite als „Anpassung“ zum Vorwurf gemacht wurde. Seine russischen Hörer aber haben es ihm gedankt und seine Musik begleitete sie mitunter bis in den Alltag hinein: Sobald sie die Nachrichten einschalteten, erklangen zur Einleitung – und passend zur sowjetischen Selbstdarstellung der Epoche – die packend-treibenden Klänge seiner Ouvertüre „Zeit, vorwärts!“, die auch zur Namensgeberin dieses abwechslungsreichen und liebevoll gestalteten Gala-Konzerts wurde.

Einen besonderen Höhepunkt stellte für uns dabei ein Wortbeitrag dar. Mit federndem Schritt hatte der auf Anhieb sympathisch und agil wirkende Komponist Vladimir Genin die Bühne betreten und trug mit wachen, lachenden Augen, die durch seine Brille hervorblitzten, Ausschnitte aus zwei Briefen vor, die Georgi Swiridow an ihn geschrieben hatte. Gaby und ich waren sofort elektrisiert und tief berührt von deren Inhalt. Wir wollten mehr erfahren und entschlossen uns spontan, Genin zu einem Gespräch ins Artist Studio München, unserem Lieblingsort für solche Begegnungen, einzuladen.

Jon Michael Winkler, damals musikalischer Leiter der Kulturplattform jourifxe-muenchen mit
Komponist Vladimir Genin (re.) im Artist Studio München, Dezember 2015
Jon Michael Winkler (JMW): Ich muss gestehen, dass ich zum Zeitpunkt der Gala nicht einmal Swiridows Namen kannte, obwohl ich von jeher die Musik russischer Komponisten liebe. Und mit dieser Unkenntnis stehe ich hierzulande sicher nicht alleine da. In russischen Kreisen hingegen genießt er offensichtlich eine sehr hohe Wertschätzung, ja immense Beliebtheit. Wie erklären Sie sich diese Diskrepanz zwischen West und Ost?
Vladimir Genin (VG): Wissen Sie, zu Zeiten des Eisernen Vorhangs wehte der Wind immer von Westen nach Osten. So haben wir in Russland immer die Bücher gelesen und die Filme angeschaut, die im Westen berühmt wurden. Umgekehrt aber gelangte wenig von der russischen Kultur in den Westen. Viele der dort entstanden großen Werke wurden im Westen kaum wahrgenommen und nicht richtig eingeschätzt. Daran hat sich bis heute eigentlich nicht viel geändert. Der wichtigere Grund im Fall Georgi Swiridows dürfte allerdings sein, dass er als zu „offiziös“ abgestempelt wurde und dass er zudem für einen modernen Komponisten als „zu traditionell“ galt. Beim Volk beliebt und zugleich Tonschöpfer ernster zeitgenössischer Musik zu sein, ist – oder scheint zumindest – unvereinbar.
JMW: Das gilt auch für Komponisten in Deutschland. Die Kriterien für „ernste Musik“ des Wertungsausschusses bei der GEMA lauten, vereinfacht gesagt: Ein im heutigen Sinn „ernstes“ Werk darf keine sangbare Melodik aufweisen, keinen durchgehenden Rhythmus und keine harmonischen Zusammenklänge. Außerdem muss die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Aufführung nach der Uraufführung äußerst gering ausfallen, eine Wahrscheinlichkeit, die nach den ersten drei Kriterien natürlich sehr hoch ist…
VG: (lacht): Ja, das trifft zu! Selbst Carl Orffs „Carmina Burana“ fällt unter die Rubrik „Unterhaltungsmusik“, wenn sie z.B. bei den beliebten Konzerten am Odeonsplatz gespielt wird…
JMW: Und Mozart könnte seine Werke heute nicht mehr als E-Musik anmelden… Aber Spaß beiseite!… Hat die Diskrepanz hinsichtlich des Bekanntheitsgrades Swiridows in Russland und hierzulande möglicherweise auch politische Hintergründe? Im Klima des „Kalten Krieges“ wurde hier ja misstrauisch beäugt, wer nicht als Dissident oder „Opfer des Systems“ galt, sondern erfolgreich seiner Berufung nachging und darüber hinaus offizielle Ämter bekleidete, wie Swiridow – Als Vorstandsmitglied des Komponistenverbandes der UdSSR und Erster Sekretär der Komponistenunion der Russischen Föderation – konnte er im Westen leicht für einen linientreuen Genossen oder zumindest opportunistischen Mitläufer gehalten werden.
VG: Das ist bei Swiridow allerdings ein komplexes Thema. Er war sicher kein Mitläufer der Partei, ja nicht einmal Parteimitglied, aber er bekleidete von ihr verliehene, hohe Ämter, wie die von Ihnen genannten. Und sicher trat er für ein starkes Russland ein, wie auch sein Umgang mit patriotischen, als „dubios“ gewerteten Künstlern zeigt.
Er war z.B. befreundet mit dem Schriftsteller Walentin Rasputin , der in seiner Anfangszeit gewiss ein großer Schriftsteller war, der schonungslos über das harte, ja grausame Leben der Bauern auf dem Land schrieb, später aber immer nationalistischere Töne anschlug, bis er schließlich ganz verstummte. Zu dieser Zeit freundete sich Swiridow mit ihm an, doch konnte ich nicht offen mit ihm über diesen Umgang streiten. Dazu war seine Stellung zu hoch und der Altersunterschied zu groß. Ich hätte ihn auch nicht vom Gegenteil überzeugen können…
JMW: Könnte man denn sagen, dass es sich bei Swiridow um einen „romantisch verklärten“ Patriotismus handelte, der auch vielen Komponisten des 19. Jahrhunderts eigen war, als die sogenannten „Nationalstile“ in Westeuropa wie in Russland aufkamen? Die Berliner Zeitung schrieb anlässlich seines Todes ja, dass Teile Swiridows Musik „mächtig“ seien, weshalb sich die sonst einander feindlich gesonnenen Kräfte der Gesellschaft an seinem Sarg vereinten. Ist seine Musik also Klang gewordene Heimatliebe?
VG: Es war viel mehr als Heimatliebe! – Swiridow hat geweint über Russland, über das, was daraus geworden war. Das hat er zwar nicht öffentlich gesagt, aber man kann das aus vielen seiner Werke heraushören:
In Vertonungen von Texten des unter Stalin verbotenen Dichters Sergej Jessenin oder das „Poem zum Gedenken an Sergej Jessenin“ (1956), über die Auslöschung des bäuerlichen Lebens nach der Revolution oder von Gedichten Alexander Blocks, die zwar keinen expliziten Protest darstellen, aber als Lieder so dramatisch sind, dass sie mit dem „sozialistischen Realismus“ eigentlich nicht vereinbar sind.
Es gibt außerdem eine kleine Kantate „Es schneit“ (1965) nach Texten des vom Regime kritisch beäugten Boris Pasternak, in der ein Kinderchor ein berühmtes philosophisches Gedicht vorträgt. Der durch diesen Kunstgriff entstehende, surrealistisch anmutende Effekt verstärkt die an sich selbst gerichteten Worte und wird so zur Aufforderung an jeden Künstler:
„…Versäum nicht, ruh nicht, Dichter!
Und halt dem Schlafe stand,
Der Ewigkeit verpflichtet,
Und von der Zeit gebannt.“
Doch damit nicht genug! Zuvor erklingt ein in der Sowjetunion wegen seines Inhalts NIE veröffentlichtes Gedicht Pasternaks, das Swiridow wohl aus einer ausländischen Ausgabe hatte, in dem es um das Leid und den qualvollen Tod der Insassen in Stalins Lagern geht. Dass es sich um diese Lager handelt, wird zwar nicht explizit gesagt, aber aus dem Kontext heraus ist es eindeutig:
Душа – Seele:
VG: Es ist völlig unglaublich, dass dieses Werk veröffentlicht, aufgeführt und auf Schallplatte gepresst wurde!
JMW: Das passt gar nicht zu der teilweisen Darstellung Swiridows als opportunistischen Mitläufer, wie sie 1998 als Nachruf im SPIEGEL veröffentlicht worden war und aufgrund dessen Sie bei Ihrem Auftritt in Gasteig mit leidenschaftlicher Schärfe eine Gegendarstellung vortrugen. Wie man allein am Beispiel dieser Kantate sehen kann, hat Swiridow angesichts des sowjetischen Machtapparats eine Menge gewagt! – Und die Partei hat wirklich nichts dagegen unternommen?…
VG: Nein, gar nichts! Und es bleibt auch ein Rätsel, wie er damit durchgekommen ist. Das sogenannte „Tauwetter“ („Ottepel“) unter Nikita Chruschtschow war mit dessen Sturz 1964 schon wieder vorbei gewesen. War es wegen seiner übrigen Verdienste – denn niemand anderes entsprach dem Bild des „Volkskomponisten“ besser als er – die ihn zu einer sakrosanten Person gemacht haben? Hat man ihm diese Vertonung quasi als „Ausrutscher“ stillschweigend verziehen? Oder lag es schlicht und einfach am Unverständnis oder der Schlamperei der Zensoren, die nicht verstanden hatten, worum es in diesem Text wirklich ging? Diese Frage wird sich vermutlich nicht mehr mit Sicherheit klären lassen …
Aber auch in seinem Pathetischen Oratorium über die Oktoberrevolution, nach Texten von Wladimir Majakowski, das als Auftragswerk unmittelbar nach dem tragischen Verlust seines Sohnes entstand, gibt es eine kaum verhüllte Provokation. Der emotional berührendste Part als Höhepunkt des Werks ist nicht das „Gespräch mit dem Genossen Lenin“, sondern der bewegende Abschied auf immer, den ein General der Weißen Armee, also ein Gegner der Revolution, von seiner geliebten Heimat Russland nimmt. Ich fragte ihn einmal, ob er das absichtlich so gestaltet hätte und er bejahte. Außerdem vertraute er mir an, dass er die Revolution als ein „sich Berauschen von Wahnsinnigen“ empfunden habe. So muss man diese suggestive und mitreißende Musik hören!…“
JMW: Ja, ein wahrhaft pathetisches Klanggemälde der historischen Ereignisse! Und durch meinen Aufenthalt in Polen vor 30 Jahren und meinen Erfahrungen mit dem kulturellen Leben und dem unglaublich aufmerksamen Publikum dort bin ich überzeugt, dass die Zuhörer in der ehemaligen Sowjetunion solche Zwischentöne auch hörten und verstanden. Musik, Literatur und Kunst waren im Ostblock mehr als ein dekoratives Beiwerk. Sie waren so unverzichtbar wie das tägliche Brot: Nahrung für die Seele eben!
VG: Ja, Kultur war für uns kein Luxus, sondern ein Mittel, das uns half, dort, wo kein offener Protest möglich war, Mensch zu bleiben. Und so hatte Jurij, wie ihn seine Freunde nannten, trotz unterschwelliger Ablehnung gegen die „Apparatschiks“ doch die hohen Ämter in den Komponistenverbänden angenommen, wohl in der Hoffnung die Situation in seinem Umfeld verbessern zu können. Doch war das nicht wirklich seine Welt. Weder war er ein Funktionär noch ein Organisator. Swiridow wollte sich seiner Musik widmen und das aus ganzem Herzen. In einem seiner Briefe an mich schrieb er später (1983) von der „Generation unserer „Wunderknaben“, die inzwischen aufgewachsen, geschäftig und aggressiv geworden seien, doch keine geistige Kraft besäßen und diese durch fades Handwerk ersetzen würden. „In den Werken dieser Epigonen, die sich wahrscheinlich gerade in unserem Lande die entscheidenden Positionen gekrallt haben, spürt man überall einen Mangel an Geist…“, so Swiridow. Aus diesen Worten kann man entnehmen, dass die vielfache Behauptung, er sei gegen die Avantgarde gewesen und hätte sie unterdrückt, nicht wahr ist, denn er spricht in seinem Brief ja ausdrücklich von „Epigonen“…
JMW: Das alles passt auch ganz und gar nicht zum Vorwurf in dem bereits erwähnten SPIEGEL-Artikel, laut dem ihn der Komponist Edison Denissow jener „Mafia“ zurechnete, deren Angehörige nur für sich, für höhere Honorare und ihre eigene Popularität gearbeitet hätten. Dieser Behauptung bin ich nachgegangen und fand heraus, dass sich Denissow wohl auf einen Vorfall bezog, mit dem Swiridow gar nichts zu tun hatte, weil er zu der Zeit schon nicht mehr dem Vorstand angehörte.
Vielmehr hatte 1979 ein anderes Vorstandsmitglied, Generalsekretär Tichon Chrennikow eigenmächtig sieben KomponistInnen scharf wegen „avantgardistischer Tendenzen“ kritisiert, unter anderem jenen Denissow sowie die später in die BRD emigrierten Sofia Gubaidulina und Viktor Suslin . Ein weiterer Komponist dieser Gruppe, Dimitri Smirnov, sprach gar von einer „schwarzen Liste“, die zu einer Unterbindung der Aufführungen ihrer Werke geführt hätte, doch belegt eine musikhistorische Untersuchung, dass die Rede Chrennikovs keineswegs zu einem Konzertboykott geführt hat. Alle sieben Komponisten wurden bei Konzerten in der Sowjetunion weiterhin aufgeführt. Die Bezeichnung „Chrennikows Sieben“ wurde eher im Westen genutzt, um zu Zeiten des kalten Krieges die „Interpretationshoheit über die sowjetische Kunst“ zu erlangen und Konzerte und Notenausgaben zu bewerben.
VG: Diese Komponisten wurden aber tatsächlich unterdrückt! Ihre Werke wurden nur sehr selten aufgeführt, wenn überhaupt und dann nicht in Moskau. Außerdem bekamen sie keine Kompositionsaufträge vom Kultusministerium. Ein fantastischer Komponist, Andrej Wolkonski , wurde aus dem Komponistenverband ausgeschlossen. Alfred Schnittke musste sich jahrelang von seinen Arbeiten für Kino und Theater über Wasser halten. Ich erinnere mich an ein vom Moskauer Komponistenverband veranstaltetes Konzert, bei dem – nach einer kurzfristigen Entscheidung – überraschenderweise Werke von Schnittke gespielt wurden. Der Publikumsandrang war so groß, dass die Eingangstüren aus den Angeln gerissen wurden. Swiridow hat mir gegenüber immer sein großes Interesse an Schnittkes Arbeit bekundet – und ich habe nie erlebt, dass er schlecht über ihn oder einen anderen Avantgardisten gesprochen hätte.
JMW: Schnittke, der übrigens im selben Jahr wie Swiridow starb, war ja im Westen hoch angesehen.
VG: Aber, natürlich! Er war schließlich offen gegen das Regime und wurde von ihm unterdrückt, weshalb er 1990 auch nach Hamburg auswanderte. Er entsprach im Westen damit dem Bild des „guten“ weil verfolgten Sowjetkünstlers; Swiridow, aufgrund seines Erfolgs und seiner hohen Ämter, entsprach hingegen dem des „bösen“. Dieses Bild stimmt aber einfach nicht.
JMW: Dieses Bild muss dringend korrigiert werden! Selbst ein ansonsten so seriöses Nachrichtenmagazin wie der SPIEGEL hat Swiridow zu Unrecht, wie wir Ihrer Darstellung entnehmen können, als „angepassten Komponisten“ deklassiert, der dem „amtlich verordneten Wohlklang“ als „parteigenehmen Reglement“ folgte und als „Sohn eines Postbeamten“ aus Kursk sich mit seinem Schaffen deshalb niemals im Westen habe durchsetzen können. – Ich glaube, dass solche Verzerrungen dazu beigetragen haben, dass wir in Deutschland – und im Westen allgemein – so wenig über Swiridows Leben und Werk wissen.
VG: Ja, aber auch der Neid und die Intrigen der russischen Kollegen im Moskauer Komponistenverband haben da eine große Rolle gespielt, und ich vermute, dass hinter diesem Artikel, angesichts seiner Schreibweise, auch ein Kollege von damals stecken könnte. – Ich selbst habe das am eigenen Leib erlebt, als mich Swiridow bei der Organisation eines Chorfestivals zu seiner rechten Hand ernannte, da er für solche Aufgaben völlig ungeeignet war. Dabei verfügte er im Komponistenverband bereits über einen offiziellen Assistenten, der zudem der Sohn des stellvertretenden sowjetischen Kultusministers war. Das führte zu vielen Irritationen und Eifersucht bei den Kollegen, die sich wunderten, wie ich als junger Mann zu solch einer Stellung gekommen war. Selbst solche, die ich für Freunde hielt, begannen Unwahrheiten über mich zu verbreiten. Richtig schlimm wurde es, als ich ein Auftragswerk der Stadt Wladimir, das Mysterienspiel „Die Klage um Andrei Bogolubsky„ (1987) schrieb. Es entstand am Vorabend von Glasnost und Perestroika zur 1000-Jahrfeier des Bekenntnisses Russlands zum Christentum und es war zu der Zeit völlig offen, ob das Jubiläum staatlich gefeiert und damit das Verbot der Aufführung „religiöser“ Werke aufgehoben würde. Doch das geschah tatsächlich! Und mein Stück wurde ein großer Erfolg – allein in Wladimir wurde es 60 Mal gespielt, bei der Firma „Melodia“ in einer Auflage von 20 000 Stück auf Schallplatte gepresst – eine für die damaligen Verhältnisse große Zahl.
Sogar eine Amerikatournee von Seattle bis San Francisco fand 1989 mit diesem Werk statt. Besonders die auf Chorwerke spezialisierten Kollegen neideten mir das ungemein und sprachen hinter vorgehaltener Hand von „Fehlern“ in meinem Werk, aber keiner sagte mir offen seine Meinung. Sogar in den Sitzungsprotokollen des Moskauer Komponistenverbands wurden Aussagen über mich festgehalten, die nicht den Tatsachen entsprachen. Sollte ich das weiter aushalten, um mir alle paar Jahre bei einem vom Verband veranstalteten Konzert den Applaus auf der Bühne abholen zu können? Nein, ab 1991 entschied ich, mich nur noch so oft wie nötig beim Komponistenverband sehen zu lassen, was selten geschah und in der Folge auch zum allmählichen „Einschlafen“ meiner Freundschaft mit Swiridow führte.
JMW: Mit der Ernennung zu seiner rechten Hand für das Chorfestival hatte er Ihnen also einen Bärendienst erwiesen…. Hat er andere junge Komponisten oder auch Sie auf andere Weise gefördert?
VG: Nein, er hat sich zwar für die „neue“ Generation interessiert – und für ihn war ich deren Verkörperung – er hat aber weder mich, noch jemand anderen im herkömmlichen Sinn „gefördert“. Er hat lediglich viel mit mir gesprochen, sah meine Partituren durch, hörte sich Aufnahmen an, für die er mir meistens Lob aussprach. Er ging dabei nicht so sehr ins Detail, der Gesamteindruck war ihm das Wichtigste. – Einmal hatte auch ich Gelegenheit den großen Kollegen zu unterstützen. Seine Augenkrankheit, eine Lichtempfindlichkeit, wegen der er getönte Brillen trug, hatte sich verschlechtert, darum bat er mich ihm zu helfen und nach seinen Anweisungen seine Kantate „Kursker Lieder“ für eine kleinere Besetzung umzuschreiben. Bei dieser Arbeit lernte ich seine Denkweise noch viel besser kennen.
JMW: Wie kam es eigentlich zu Ihrer Bekanntschaft?
VG: Durch meinen damaligen Professor im Musikstudium. Er hatte mir damals die Aufgabe erteilt, ein Werk von Swiridow zu analysieren. Ich war zunächst nicht begeistert davon, aber als ich daran arbeitete, erkannte ich die Tiefe und Kunstfertigkeit seiner Musik und dementsprechend motiviert schrieb ich darüber. Ich wusste ja nicht, dass mein Professor die Arbeit an Swiridow zum Lesen weiterleiten würde. Darauf folgte eine Einladung an mich auf seine Datscha in der Nähe von Moskau, wo viele bekannte russische Künstler und Wissenschaftler lebten. Auf der einstündigen Autofahrt schärfte mir mein Professor ein, Swiridow ja nicht zu widersprechen und auf keinen Fall mit ihm zu diskutieren, denn er wusste, wie aufbrausend und stur Swiridow sein konnte.
JMW: Und haben Sie sich daran gehalten?
VG: Nein, das konnte ich nicht! Als er über einen Zeitungsartikel sprach, war ich anderer Meinung und eröffnete mit der, spätestens seit der öffentlichen Verdammung Dr. Schiwagos , in Russland eigentlich fatalen Floskel: „Also, ich habe das zwar nicht gelesen, aber…“. Schon war die Diskussion in vollem Gang. Mein Professor wollte eingreifen, aber das verbat sich Swiridow. Er schickte ihn in die Küche, um seiner Frau bei der Vorbereitung des Abendessens zu helfen, damit er ungestört mit mir reden konnte. Das tat er übrigens immer wieder. (Lacht.)
JMW: Da hatten sich wohl zwei Feuerköpfe getroffen! Das passt auch sehr gut zu dem Brief den er Ihnen nach Ihrer ersten Begegnung schrieb und den Sie bei der Gala ihm zu Ehren vorgetragen haben:
„Ich bin dem Schicksal sehr dankbar für die Gelegenheit, durch die Begegnung mit Ihnen das intensive Leben der neuen Generation empfinden zu dürfen. Behalten Sie dieses Feuer – das wertvollste auf der Welt, weil das Leben ohne es verlischt, verfault… Ich habe viel in meinem Leben gesehen und lernte dieses Feuer zu schätzen. Aber seien Sie geduldig – keiner wird von den Leuten sofort verstanden. Man muss viel sagen, bevor die Leute anfangen zuzuhören, geschweige denn anfangen zu verstehen.“
VG: Den Brief hat er mir erst nach mehreren Begegnungen geschrieben, aber der Anfang davon war natürlich dieser Tag.
JMW: Bleibt zum Abschluss unseres Gesprächs noch der andere Brief, den sie als sein Vermächtnis bezeichnet haben; ein Vermächtnis, das an Sie und Ihre Freunde und damit ganz allgemein an die Generation nach ihm gerichtet ist. Swiridow schreibt darin unter anderem:
„Ihre Aufgabe ist groß und schwierig: Vieles aufzuklären und den wahren Maßstab der Werte wiederzufinden – den Maßstab, der verloren gegangen ist... (Unter den geistlosen und opportunistischen „Epigonen“) … Meine Aufgabe an Sie und Ihre Freunde ist es, zu suchen. Sonst wird unsere Musik nicht mehr zum Ausdruck der Essenz menschlichen Lebens, der Essenz, die verborgen ist und erst durch die Kunst offenbart wird.“
JMW: In wie weit hat Sie dieses Vermächtnis inspiriert? Was genau meinte er mit dem verlorenen Maßstab und der verborgenen Essenz?
VG: Der Maßstab war sicher musikalisch wie menschlich gemeint.
Es ging Swiridow um den wahren und bleibenden Wert, wie wir ihn in der Musik der großen Komponisten verehren. Und er selbst schien „riesig“, in seiner Ausstrahlung, seinem Charisma. Er hatte zwar nicht die Stimme dazu, aber niemand hat vom Ausdruck her seine Lieder besser vorgetragen als er selbst, wie eine private Aufnahme mit meinem Freund, dem Pianisten Michail Arkadiev es zeigt. So wie er da singt, das ist reine Essenz, ohne jedes Theater!
Schon vor meiner Begegnung mit Swiridow hatte ich immer Menschen gesucht, die so eine Sicht vertreten. Auch meinen Professoren beim Studium ging es um diesen Ausdruck, um eine Musik, die etwas über den Menschen aussagt.
Swiridow aber wirkte in dieser Hinsicht wie ein gewaltiges Schiff und die anderen um ihn herum nur wie kleine Boote. Er hatte zwar seine Fehler, er war unpraktisch, manchmal stur und aufbrausend, doch letztlich war er ein grandioser Mensch. Aber „vergöttert“ habe ich ihn nie! Mit der Zeit habe ich immer mehr das Wesentliche in seiner Musik entdeckt, zwar auch in seinen präzisen handwerklichen Fähigkeiten und seiner ganz speziellen Sparsamkeit in der Wahl der Mittel, aber noch vielmehr in der spirituell-geistigen Essenz dahinter.
JMW: Ich habe gelesen, dass er über 34 Jahre an seinen geistlichen Chorwerken gearbeitet hat, die sicher als Ausdruck dieser geistig-spirituellen Essenz zu verstehen sind; viele davon entstanden erst in den 80er und 90er Jahren. Obwohl es die Unterdrückung der russisch-orthodoxen Kirche zu jener Zeit schon nicht mehr gab, wurden viele dieser Werke erst nach seinem Tod herausgegeben. Sie erzählten, dass zudem in seiner Wohnung noch stapelweise unveröffentlichte Werke in seinen Schränken lagerten und angesichts dessen frage ich mich, wie es um das musikalische Erbe Swiridows steht? Wird seine Musik heute noch gespielt und wird sie auch in Zukunft gespielt werden?
VG: Ja, sie wird noch gespielt und auch gespielt werden, denn es gibt wohl kaum einen besseren Ausdruck dessen, was man die „russische Seele“ nennt. Wenn Sie Filme von typisch russischen Landschaften sehen, sind diese zu 50 Prozent mit Musik von Swiridow unterlegt – dafür gibt es einfach nichts besseres. Allerdings läuft sie gerade deswegen auch immer Gefahr, von allen Seiten missbraucht zu werden, von den Anhängern der alten Brigaden wie von den neuen Nationalisten. Im Ausland gestaltet sich die Lage für Aufführungen schon schwieriger, da sein Name dort wenig bekannt ist und daher weniger „zahlendes Publikum“ zieht; das gilt natürlich auch für die Veröffentlichung von Noten und Tonträgern. –
Verstanden aber wird Swiridows Musik nur von denen werden, die ihre Essenz begreifen – und da gibt es nicht so viele in unserer schnelllebigen und auf Äußerlichkeiten ausgerichteten Zeit. Die innere Einstellung zum wahren Wert der Kunst, des Geistigen müsste sich dazu erst einmal ändern und meist geschieht das nur durch dramatische äußere Umstände…
JMW: Abschließen möchte ich mit einem Zitat, dass mir in den von Ihnen gesendeten Unterlagen ins Auge gestochen ist. Für mich trifft es sehr gut die Essenz der „russischen Seele“ in der Kunst, der Musik und in Georgi Swiridows Werk. Es stammt von der amerikanischen Autorin Suzanne Massie, die in ihrem Buch „Land des Feuervogels“ schreibt:
„Das Vermögen, die Schönheit der spirituellen Welt und die Fähigkeit, diese Schönheit durch Verehrung auszudrücken, war eine besondere Gabe Russlands. Durch die Jahrhunderte haben die Russen, selbst in ihrer weltlichen Kunst, ihre Sicht erhalten, dass Kunst vor allem ein göttliches Geschenk ist, dessen grundlegender Zweck es ist, Gott zu dienen und die Menschheit zu erheben.“
Entdecke mehr von Gaby dos Santos
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.