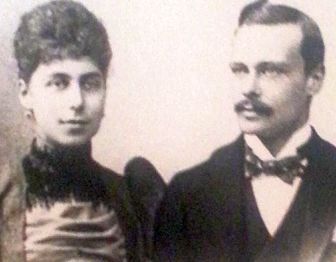Blut und Klang im Doppelpack … Ausgerechnet die Tartaren sollen im 13. Jahrhundert die Domra als Musikinstrument nach Russland eingeführt haben. Dort avancierte sie schnell zum bevorzugten Instrument fahrender Spielleute, die ein ganze Land mit diesem der Laute verwandten Instrument verzauberten. Dermaßen verzauberten, das es das Volk an Sonntagen eher zum Open Air auf den Marktplatz zog, als in die Messe. Die Reihen der Gläubigen bei den sonntäglichen Gottesdiensten sollen sich unaufhaltsam gelichtet haben. Schließlich beschwerte sich die Kirche bei der Obrigkeit im Namen des Herren. Darauf erging ein Erlass, alle Domras zu konfiszieren und alle runden Saiteninstrumente künftig zu verbieten. Nur wollte das Volk sich diese Art von Klang-Genuss auf Dauer nicht verbieten lassen. Dies war die Geburtsstunde der – nicht länger runden – sondern nunmehr dreieckigen Balalaika.
Diese faszinierende Geschichte erzählte mir die Domra-Spielerin Maria (Mascha) Belanovskaya, meine Zimmergenossin beim russischen Festival in Coburg. Sie selbst gilt als eine der besten russischen Domra-Spielerinnen, wie mir MIR-Präsidentin Tatjana Lukina später verriet. Dass dieses Instrument inzwischen wieder Kernbestandteil der russischen Volksmusik ist, verdanken wir Wassili Wassiljewitsch Andrejew, der die Domra um 1896 auf der Basis von alten Zeichnungen und Instrumentenfragmenten rekonstruierte. Doch war dieses traditionelle Instrument für Mascha keineswegs erste Wahl. „Ich wollte Klavier spielen,“ gestand sie mir. „Und ich war begabt!“ fügte sie mit Nachdruck hinzu. Doch die Mutter drängte sie, wohlmeinend, sich an der Domra ausbilden zu lassen. Damals bestand noch der Eiserne Vorhang und die Chancen auf internationale Tourneen, auch in den Westen, schienen mit diesem traditionellen russischen Instrument aussichtsreicher, als mit dem Klavier, das weltweit beherrscht wird. Die gleiche Mascha, die mir eben noch mit blitzenden Augen die Entstehungsgeschichte ihres Instruments geschildert hatte, wirkte plötzlich traurig, als sie fragte: „Aber heute? Wer braucht denn schon heute noch eine Domra-Spielerin?„
In Deutschland lebt die St. Petersburger Künstlerin erst seit Ende letzten Jahres, ist hier frisch verheiratet, spricht jedoch bereits hervorragend Deutsch. – Und erwies sich im Verlauf unseres langen Pyjama-Talks ganz unerwartet als Bindeglied zu einer entscheidenden Phase in meinem Leben: Mascha berichtete nämlich, dass ihr geschiedener Mann, der Balalaika-Spieler Alexander Kutschin, mit dem sie bis heute im Trio arbeitet, 1991 für kurze Zeit in einer russischen Datscha in München aufgetreten sei. „In der Paradiesstraße 8“, ergänzte sie, worauf es bei mir „klick“ machte. Zu jener Zeit hatte ich um die Ecke im Lehel gewohnt und mich in die Atmosphäre dieses Lokals verliebt, das in seiner Anfangszeit viele kleine und auch größere Besonderheiten „made in Russia“ auszeichnete: So fanden sich fast dreißig verschiedene Vodka-Sorten auf der Getränkekarte, und das geleerte Glas durfte man in eine eigens dazu eingerichtete Ecke schleudern, was sich nicht nur als idealer Blitzableiter bei aggressiven Befindlichkeiten erwies, sondern auch zu so manchen Exzessen verführte. Die schummrige Atmosphäre des Lokals und die sentimentale Stimmung, in die mich russische Klänge seit jeher versetzen, sollte für mich zur Kulisse einer Reihe von Begegnungen und Erlebnissen werden, die die Weichen für meinen weiteren Werdegang stellten … Rückblickend bezeichne ich diese Zeit als meine „russische Phase“ , begleitet natürlich vom entsprechenden Soundtrack an russischer Livemusik.
Auf das ganze Land übertragen, formuliert es der große russische Dichter Fjodor Tjutschew so:
Mit dem Verstand ist Russland nicht zu fassen, Gewöhnlich Maß misst es nicht aus:
Man muss ihm sein Besond’res lassen – Das heißt, dass man an Russland glaubt.
Diese so anrührend treffende Beschreibung wählte die Schauspielerin und Journalistin Tatjana Lukina zum Motto jenes Vereins, den sie im selben Jahr meiner Datscha-Abenteuer ins Leben rief: MIR (Russisch für „Frieden“) – Verein für kulturelle Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion, gegründet 1991.
Nur wer selbst mit Kulturarbeit in Berührung gekommen ist, kann ermessen, was es heißt, eine kulturelle Institution über einen so langen Zeitraum mit immer neuen Inhalten zu füllen und am Leben zu halten. Verdientermaßen erhielt sie dafür
- 2006 die Puschkin-Medaille für Verdienste auf dem Gebiet der Kultur und Aufklärung sowie der Annäherung und wechselseitigen Bereicherung der Kultur der Nationen und Völker.
- 2011 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland
- Nachtrag: 2020 die Medaille „München leuchtet“ in silber
Und Tatjana Lukinas Arbeit scheint mir nie wichtiger gewesen zu sein, als heute, denn sie vermag kulturell Brücken zu schlagen, in einer Zeit, in der das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland leider wieder auf eine neue Eiszeit zuzusteuern scheint. Als gebürtige Berlinerin, Jahrgang 1958, stimmt mich das besonders traurig, noch zu präsent ist mir das Schreckensszenario meiner Kindheit, das da lautete: „wenn der Russe kommt …“.
Die Gründung von MIR fiel mit dem Fall der Sowjetunion zusammen, auf die eine kurze Phase politischen Tauwetters folgte. Der bedrohliche Russe meiner Kindheit schien endgültig Makulatur. Um die Jahrtausendwende setzte sogar ein kurzer Putin-Hype in Deutschland ein, schließlich wirkte er drahtig, beherrschte eine asiatische Kampfsportart und sprach sogar fließend Deutsch … Nun fällt Volkes Meinung ja gerne von einem Extrem ins andere und so ist zwischenzeitlich wieder viel Porzellan zertrümmert worden, international, quer durch alle politischen Lager und insbesondere seinerzeit seitens der Bush-Administration. Inzwischen genügt es hierzulande, lediglich für eine ausgewogenere Berichterstattung in puncto Russland/Putin zu plädieren, um einen halben Shit Storm im Netz auszulösen. Um so härter muss es für Tatjana Lukina sein, in solcherart Stimmungslage unbeirrt russische Kultur auf hohem Niveau zu präsentieren …

Leider fühlen sich viele Menschen im Moment, so scheint es mir, auf Grund ihrer Ablehnung gegenüber der Politik Putins auch zu einer Ablehnung Russlands insgesamt genötigt. Dabei wird leicht übersehen, dass ganz Europa historisch verwoben ist, so auch, beispielsweise, die russische Geschichte mit der bayerischen. So hat MIR im Jahr seines 25. Jubiläums konsequenterweise eine kulturhistorische Spurensuche ausgerufen:
Bereits Anfang September lud MIR zu einem Kulturwochenende nach Coburg. Anlass war der 140. Geburtstag von Prinzessin Victoria Melita von Sachsen-Coburg und Gotha (1876 – 1936), der späteren Großfürstin Victoria Fjodorowna von Rußland. Diese Dame blickt auf eine Vita zurück, die bezüglich ihrer Dramatik Caroline von Monaco und den gesamten Grimaldi-Clan – damals wie heute – blass aussehen lässt. Victoria, eine der zahllosen Enkel_Innen von Europas Queen Victoria, verlor schon früh ihr Herz an den russischen Großfürsten Kyril Romanov, ein Cousin. Auf Grund dieser familiären Verhältnisse verbot sich laut dem orthodoxen Glaubenskodex eine Ehe. Stattdessen heiratete sie in das Haus Hessen ein. Aus dieser Verbindung ging eine Tochter hervor. Diese Ehe jedoch nicht glücklich.
Als Victoria ihren Mann schließlich in Flagranti mit einem Kammerdiener ertappte, trennte sie sich von ihm, ein für damalige Zeiten unerhörter Schritt. Dennoch blieb ihr zunächst eine Scheidung verwehrt, maßgeblich seitens ihrer mächtigen englischen Großmutter, der eine Scheidung in der Familie als „no go“ galt. Erst nach deren Ableben erfüllte sich für Viktoria ihr Herzenswunsch und sie wurde Kyrils Frau Vicoria Fjodorowna, Großfürstin von Russland und später Zarin im Exil. „Prinzessin Ducky, eine Europäerin mit drei Schicksalen“ lautete der Titel der ihr gewidmeten literarisch-musikalischen Lesung, der der Oberbürgermeister, Norbert Tessner (SPD), beiwohnte, der auch die Schirmherrschaft des Festivals, das bereits zum dritten Mal in in Coburg stattfand, übernommen hatte.

Um Schicksalsschläge und die Dramatik großer Gefühle ging es auch in den weiteren Programmpunkten. Einer davon war die weltberühmte Liaison des jungen Rainer Maria Rilke mit der älteren Russin Lou Andreas Salome, die in einer Collage aus historischen Dokumenten und Briefen von Schauspielerin Karin Wirz und ihrem Partner intensiv nachempfunden wurde. Für mich noch spannender, weil mir das Thema dank der Biografie von Gunna Wendt: Lou Andreas Salome und Rilke, „Eine amour fou“ bereits vertraut war. »War ich jahrelang Deine Frau, so deshalb, weil Du mir das erstmalig Wirkliche gewesen bist« schrieb diese starke Frauenpersönlichkeit an ihren Geliebten. Als aus ähnlich hartem Holz geschnitzt erwies sich auch die St. Petersburger Aristokratin und Komponistin Olga Smirnitskaja. Ihretwegen drehte sich Walzerkönig Johann Strauß Sohn, normalerweise ein notorischer Frauenheld, regelrecht im Karree und schrieb ihr 100 Liebesbriefe.
Dieser weiteren Romanze hauchten Anna Sutyagina und Artur Galiandin an diesem Abend Leben ein.
Der bedingungslosen Hingabe, mit der Ehefrauen ihren Männern zu Weltruhm verhalfen und dabei selbst weitgehend im Schatten blieben, widmete sich die Lesung aus dem Buch „Am Anfang war die Frau“ von Tatjana Kuschtewskaja, wobei mich während der Lesung die Frage beschäftigte, inwieweit diese Bedingungslosigkeit der Tatsache geschuldet war, dass sich Frauen damals nur über ihren Ehegatten definieren konnten und ihnen daher gar keine andere Wahl geblieben war.
Nicht zufällig trugen Frauen früher die Titel des Gatten mit im Namen. In ihrer Reihe biografischer Miniaturen kommt Tatjana Kuschtewskaja auch auf die unglückliche Liebe von Antonina Iwanowna Miljukowa zu sprechen, die eine aussichtslose Leidenschaft zu dem großen Pyotr Iljitsch Tschaikowski hegte. Zwar mündete ihre Liebe 1877 in eine Ehe, doch war auf Betreiben des Komponisten von Anfang an vereinbart, dass beide lediglich „in geschwisterlicher Verbundenheit“ zusammenleben würden. Dennoch verließ Tschaikowski bereits nach drei Monaten das eheliche Heim. Tschaikowski, dem sich auch die abschließende Soirée „Tschaikowski und der Kini“ widmete, war aller Wahrscheinlichkeit nach schwul und daher zu einem Doppelleben gezwungen, das sein nach außen hin so erfolgreiches Leben dramatisch überschattete, bis zu seinem unerwarteten und Geheimnis umwitterten Tod. Hierzu fasst Wikipedia zusammen:
Tschaikowski starb überraschend im Herbst 1893, im Alter von 53 Jahren in St. Petersburg. Wenige Tage zuvor hatte er noch seine Pathétique dirigiert. Die Todesursache konnte bis heute nicht eindeutig geklärt werden. Dazu werden zwei Meinungen vertreten. (…) Die eine besagt, er habe sich mit der damals in St. Petersburg grassierenden Cholera, infinziert, als er ein Glas unabgekochten Wassers (…) trank. (…) Nach der anderen These hat sich Tschaikowski mit Arsen vergiftet (…) Angeblich war er von einem „Ehrengericht“, bestehend aus Mitgliedern der St. Petersburger Rechtsschule, an der er selbst studiert hatte, mit dem Hinweis auf seine Homosexualität aufgefordert worden, sich das Leben zu nehmen.
Auf beide Thesen ging Artur Galiandin in der Soiree ein; eine von vielen historischen Randnotizen, die mir während des Kultur-Wochenendes in Coburg begegneten und sehr berührten, sind es doch solche Details, die Geschichte wieder nachvollziehbar in Form lebendiger Geschichten machen. Sie wolle Wissen vermitteln, dies aber auf eine unterhaltsame Art und vor allem dabei im Publikum auch Emotionen wecken, erklärte sie mir. Gerade letzteres Anliegen teile ich und finde es bei MIR-Veranstaltungen immer wieder wunderbar umgesetzt, nicht zuletzt auf Grund der Musik-Beiträge, die fester Bestandteil von Lukinas Programmen sind, zu denen sie auch stets selbst das Skript formuliert; ein zusätzlicher kreativer Kraftakt, den Lukina auch dank eines festen Ensembles aus versierten Künstlerinnen und Künstlern regelmäßig stemmt. Dank dieser festen Konstante wirkte die breit aufgestellte Themenpalette des Festivals wohltuend „wie aus einem Guss“ und sorgte auch jenseits der Veranstaltungen für eine familiäre Bindung zwischen dem künstlerischen Ensemble und dem mitgereisten Teil des Publikums, weitgehend MIR-Stammpublikum, wie mir schien. Grundsätzlich erlebe ich das Umfeld von MIR wie eine große Familie, die sich in regelmäßigen Abständen, vor und auf der Bühne, der russischen Kunst und Kultur widmet.

Flair „für mau“ bot der Veranstaltungsort selbst, das prächtige Schloss Ehrenburg in der Coburger Altstadt. Oft verströmt das Interieur von Schlössern tote Pracht. Nicht so die Räumlichkeiten dieses Schlosses, in dem ich mir am Sonntag Vormittag in der Künstlergarderobe einen improvisierten Arbeitsplatz geschaffen hatte.
Vom Aufenthaltsraum aus, in dem barockes Weiß, Silbergrau und Gold dominierten, führten verschachtelte Gänge in immer neue Räume, ausgekleidet in farblich wechselnden Seiden-Tapeten, ausgestattet mit großformatigen Portraitbildern in Öl, die von anderen Zeiten erzählten, deren Sitten und Moden.
Die Werke, unter denen Bassbariton Frits Kamp auch einen Rembrandt vermutete, wie mir meine improvisierte Schlossführerin, Schauspielerin Cornelia Pollak berichtete, zeigten hochwohlgeborene Familien, die einst hier wohnten, lebten und natürlich auch ausgiebig – sonst wären einige von ihnen nicht Protagonist_Innen eines russischen Festivals – liebten …
Später setzte ich meinen Rundgang alleine fort, wann hat man schon ein ganzes Schloss für sich, von dem Gefühl begleitet, die früheren Bewohner_Innen seien nur eben einmal ausgeritten und bald wieder zurück. Auch als Kulisse für die Vorstellungen erwies sich der Ort als kongenial, besonders bei Auftritten von Sopranistin Tatjana Furtas, deren Roben sich optisch perfekt in das Gesamtbild einfügten.
Lichtregie führten die Tages- und Abendzeiten, die den Festsaal in wechselnde aber stets intensive Stimmungen tauchten. Neben den Darbietungen selbst faszinierte mich auch die Atmosphäre Backstage, zwischen den Veranstaltungen. Meine Eindrücke habe ich vor Ort festgehalten: Glockenhelle Sopranstimmen, vereinzelte Klavier-Klänge aus dem Festsaal, von anderswo her vernehme ich Fragmente russischer Volksmusik, russische Sprachfetzen mischen sich unter deutsche Konversation, hier geht jemand noch seinen Text durch, dort wird gebügelt, die typische Backstage-Szenerie in Barock-Version, heimelig in das schummerige Licht eines verregneten Mittags getaucht. Das ist meine – Künstler – Welt, hier fühle ich mich ganz bei mir …
Entsprechend melancholisch war mir während der Heimfahrt zumute, zumal die beständige Abfolge von Programmen während der beiden Festival-Tage eine Art poetischen Sog entwickelt hatten, den ich nun jäh vermisste. Nach zwei hauptsächlich in den Gemächern eines Schlosses, mit Geschichten aus vergangenen Zeiten und klassischer Musik verbrachten Tagen, kam ich mir vor, als würde ich nach einer durchzechten Nacht in das grelle Licht der Realität zurück kehren. Gnädigerweise zeigte sich der Himmel allerdings wolkenverhangen und der Vorplatz des Schlosses hatte sich in eine Budenlandschaft mit kulinarischen Angeboten von A bis Z verwandelt, was mir den Weg zurück in die Sachlichkeit des Alltags erleichterte. Während der Bus sich ein letztes Mal einen Weg durch die Altstadtgassen bahnt, fühle ich mich, abgesehen von einer leisen Melancholie, glücklich und erfüllt.
Das Coburger Festival endete mit einem berühmten Zitat von Tschaikowski:
Musik beginnt dort, wo Worte enden …
Ein Seele und Geist bereicherndes Wechselspiel, das an diesem September-Wochenende, 24./25.9.2016, im Münchner Kulturzentrum Gasteig fortgesetzt wird:
Wieder hat Tatjana Lukina mit ihrem Ensemble und einigen Gästen aus Kunst und Kultur ein vielfältiges Programm für zwei Festival-Tage vorbereitet, zur Feier des 25. Jubiläums bei freiem Eintritt! Auch hinsichtlich dieses Programmes bleibt MIR sich treu; erzählt in der Veranstaltung: „Ein Schwiegersohn für den Zaren“ von der Romanze von Maximilian Herzog von Leuchtenberg (1817-1852) – Sohn von Napoleons Stiefsohn, Eugène de Beauharnais und Enkel des ersten bayerischen Königs Maximilian I. – und der Tochter des Zaren Nikolaus I., Großfürstin Maria Romanowa (1819-1876). Mit ihrer Heirat 1839 gründeten sie die einzige bayerisch-russische Dynastie (…)
Ebenfalls in München unterschrieb ein Russe zum ersten Mal mit einem Pseudonym: Lenin! Über seinen zweijährigen Aufenthalt in unserer Stadt berichtet die Lesung: „Wladimir Uljanows (Lenin) Exil in München“. Weitere Veranstaltungen sind so unterschiedlichen russischen Persönlichkeiten gewidmet, wie Väterchen Timofej, bekannt, bis zu seinem Tod 2004, als DER Eremit von München oder Alexander Schmorell (seit 2012 Hl. Alexander von München). Über sein Leben und Sterben berichtet der Dokumentarfilm „Widerstand der Weißen Rose„. An der Diskussion nach dem Film nimmt u. a. der Biograf von Schmorell, Dr. Igor Chramow (Orenburg) teil. Regie: Sergej Lintsow und Roman Saulskij, Direktor Alexej Egorytschew (Filmgesellschaft „Sozwezdije Kino“, Produzent Wadim Aslanjan, 2015).
Selbstverständlich stehen auch Portaits russischer Frauen wieder im Mittelpunkt: Besonders schöne, wie UFA-Star Olga Tschechowa, besonders Geheimnis umwitterte, wie Anna Anderson-Manahan, die als angebliche Zarentochter Anastasja weltweit für Aufsehen sorgte oder besonders begabte, wie Malerin Marianne von Werefkin in dem Dokumentarfilm „Ich lebe nur durch das Auge“ von Stella Tinbergen, mit Lena Stolze in der Hauptrolle … Alle Programmpunkte finden sich im virtuellen MIR-Flyer
Am Ende meiner Ausführungen zu 25 Jahren MIR und den damit verbundenen aktuellen Festivitäten, gestatte ich mir aus dem Grußwort des damaligen Generalkonsuls der Ukraine in München, Yuriy Yarmilko, zu zitieren, geschrieben 2010, für die Festschrift zum 20jährigen MIR-Bestehen:
Mich als Generalkonsul der Ukraine in München freut es sehr anzumerken, dass viele kulturelle Veranstaltungen und Gedenkabende der Ukraine gewidmet waren. (…) Viele haben noch in Erinnerung: Gogol-Tage in München, die unter der Schirmherrschaft der ukrainischen und russischen Generalkonsule durchgeführt wurden und dem 200 Geburtstag des Schriftstellers gewidmet waren. Mein besonderer Dank gilt für die Aufführungen der ukrainischen Theater(Stücke), die dank Ihren Bemühungen auf den angesehenen Theaterbühnen Münchens vorgestellt werden konnten. Heute setzen Sie Ihre mühsame Arbeit zum Nutzen heutiger und zukünftiger Generationen fort. Die neuen Ideen, Veranstaltungen und Publikationen gewährleisten eine lebendige Verbindung zwischen den Ländern, Zeiten und Kulturen.
Yuriy Yarmilko, 2010 ukrainischer Generalkonsul
Hier findet sich auf den Punkt gebracht, was Kultur leisten kann und das Team von MIR, allen voran Tatjana Lukina, über ein Vierteljahrhundert geleistet hat und hoffentlich noch lange leisten wird, wenn es sich mit Veranstaltungsreihen und Publikationen wie „Russische Spuren in Bayern“ und „Das russische München“ (beide von MIR), auf die Spuren dessen begibt, was uns verbindet und uns hier in München am vielfältigen Erbe der Kulturnation Russland teilhaben lässt.
Fotos: Raissa Konovalova, Elena Weich/MIR und Gaby dos Santos
Entdecke mehr von Gaby dos Santos
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.